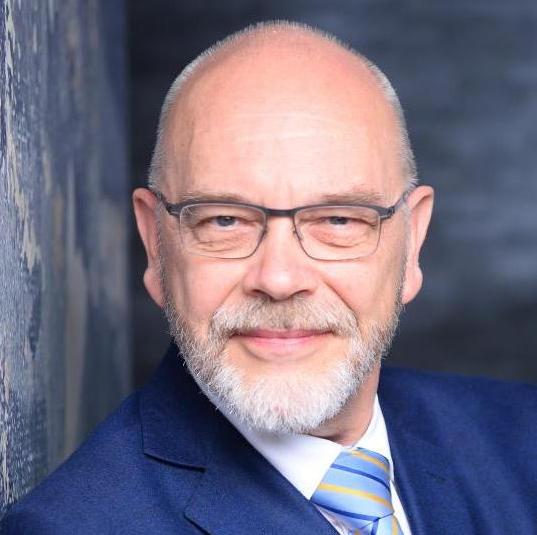Das Selbstleseverfahren – Was Schöffen wissen sollten
Hasso Lieber
Abstract
Auf das Verlesen zahlreicher und umfangreicher Urkunden und anderer Unterlagen, die als Beweismittel dienen, kann verzichtet werden, wenn – nach Anordnung des Vorsitzenden – die Richter und Schöffen diese außerhalb der Hauptverhandlung selbst lesen und die anderen Beteiligten Gelegenheit dazu hatten. Die zu verlesenden Dokumente müssen genau bezeichnet und identifizierbar sein. Den Schöffen muss ausreichend Gelegenheit gegeben werden, die Dokumente tatsächlich zu lesen.
The reading aloud of numerous and extensive documents and other papers serving as evidence may be dispensed with if, upon the order of the presiding judge, the judges and lay judges have read the documents outside the main hearing and the other parties involved have had the opportunity to do so. The documents to be read must be precisely designated and identifiable. The lay judges must be given sufficient opportunity to actually read the documents.
I. Das Selbstleseverfahren in der StPO
Die Verfahrensgrundsätze der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit sowie der Öffentlichkeit gebieten, dass alle Beweismittel in der mündlichen Hauptverhandlung in Anwesenheit aller Mitglieder des Gerichts zur Kenntnis genommen werden und die im Saal Anwesenden der Beweisaufnahme folgen und sich ein eigenes Bild machen können. Der Einlassung des Angeklagten, der Aussage des Zeugen und den Ausführungen des Sachverständigen können Beteiligte wie Zuhörer relativ problemlos folgen und – bei strukturierter Befragung – nachvollziehen. Schwieriger kann die Einführung des Inhaltes von schriftlichen Beweismitteln (Urkunden) in das Verfahren werden. Um das Prinzip der Öffentlichkeit zu gewährleisten, werden Urkunden, deren Inhalt für die Beweisführung erheblich sind, verlesen. Insbesondere in Wirtschaftsstrafverfahren gerät diese Methode an ihre Grenzen. Stundenlanges Vorlesen von Schriftstücken – insbesondere, wenn es viele Zahlen enthält, die zudem noch mit denen in anderen Urkunden verglichen werden müssen – überfordert nicht nur die Konzentration auch des aufmerksamsten Zuhörers, sondern auf Dauer selbst der Mitglieder des Gerichts.
Der Gesetzgeber hat daher 1979 mit § 249 Abs. 2 StPO das sog. Selbstleseverfahren eingeführt1 und seine Anwendung 19872, 19943 und 20174 ausgedehnt. In diesem Verfahren wird der Beweis dadurch erhoben, dass alle Mitglieder des Gerichts – Berufsrichter und Schöffen – die beweiserheblichen Urkunden außerhalb der Hauptverhandlung lesen und die Verfahrensbeteiligten hierzu Gelegenheit erhalten. Welche Urkunden für das Selbstlesen in Betracht kommen, wird durch den Vorsitzenden im Rahmen seiner Sitzungsleitung angeordnet. Seit der Einführung des Selbstleseverfahrens hat nicht nur die Zahl der Fälle zugenommen, in denen dieses Verfahren angeordnet wurde; auch der jeweilige Umfang der zu lesenden Dokumente wurde beständig größer. Man stelle sich vor, dass in einem Strafverfahren Kontoauszüge, Steuerunterlagen, Bilanzen usw. verlesen werden müssen, um Steuerbetrug, Bilanzfälschungen, Unterschlagungen oder Untreuedelikte – oft in Millionenhöhe – zu beweisen. Hier nimmt der Umfang der zu lesenden Schriftstücke nicht selten mehrere tausend Blatt, inzwischen sogar in fünfstelliger Höhe an.5 Die fortschreitende Digitalisierung tut ein Übriges zur Vermehrung verlesbarer Beweismittel (E-Mails, Chats in Messenger-Diensten, PDF-Dokumente usw.), die im Selbstleseverfahren Eingang in die Beweisaufnahme finden.
II. Ablauf des Verfahrens
Drei Stufen markieren das Verfahren: Die Anordnung des Selbstlesens trifft der Vorsitzende, der auch die entsprechenden Dokumente übergibt (1.). Gegen dessen Entscheidung kann Widerspruch erhoben werden, über den das (gesamte) Gericht entscheidet (2.). Auf das tatsächliche Lesen außerhalb des Gerichtssaals folgt die Feststellung, dass die Mitglieder des Gerichts die Dokumente gelesen haben und die Beteiligten die Möglichkeit hierzu hatten, womit das Selbstleseverfahren formell endet (3.).
1. Selbstleseanordnung
Mit der Selbstleseanordnung definiert der Vorsitzende die zu lesenden Dokumente – bestimmt damit dessen Umfang – und legt den Zeitraum fest. Über Gegenstand und Umfang der Beweisverwendung darf kein Zweifel bestehen. Die Bezeichnung von Urkunden muss bei der Anordnung so genau sein, dass sie vor allem für die Schöffen identifizierbar sind und keine Missverständnisse auftreten können. Die Schöffen müssen beim Vorsitzenden nachfragen, wenn Unklarheit besteht, welche Dokumente zwingend zu lesen sind. Wird eine Vielzahl an Dokumenten überreicht, die nur in Teilen oder Auszügen zur Beweisführung in Betracht kommen, muss der beweiserhebliche Umfang in der Anordnung so genau beschrieben werden, dass – etwa bei Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe – vor allem bei den Mitgliedern des Gerichts keine unterschiedlichen Würdigungen hinsichtlich der maßgeblichen Dokumente entstehen können.6 Spätestens mit der Anordnung sind den Schöffen die Unterlagen zu übergeben, ggf. nach Einscannen in digitaler Form. Nach inzwischen übereinstimmender Auffassung in Rechtsprechung und Literatur darf der Vorsitzende den Schöffen das Selbstlesekonvolut schon vor der Anordnung, ggf. vor Beginn der Hauptverhandlung aushändigen.7
Wie schlussfolgert ein Schöffe beim Lesen, welche Teile des Konvoluts mit welchem Gewicht für die Beweiserhebung welchen Vorwurfs erheblich sind? Neben den Unterlagen des Selbstleseverfahrens ist den Schöffen zumindest der Anklagesatz zu übergeben.8 Ansonsten ist kaum zu beurteilen, welcher Beweis bei mehreren Anklagepunkten welcher Tat zuzuordnen ist, wenn nicht anhand des Anklagesatzes jede einzelne Tat und jeder einzelne Umstand identifiziert werden kann. Das einmalige Verlesen des Anklagesatzes zu Beginn der Hauptverhandlung wird dazu kaum ausreichen. Noch besser wäre die Überlassung der gesamten Anklageschrift, um einen gleichen Wissens- und Erkenntnisstand der Schöffen mit Berufsrichtern, Staatsanwaltschaft und Verteidigung herzustellen. Da den Schöffen die schriftlichen Unterlagen vorliegen, werden sie diese von evtl. Wertungen der Staatsanwaltschaft im wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen zu trennen wissen – immer vorausgesetzt, die Wahlgremien haben bei der Schöffenwahl ihre Arbeit pflichtgemäß erledigt.
2. Widerspruch gegen das Selbstleseverfahren
Gegen die Anordnung des Selbstleseverfahrens kann von den Beteiligten Widerspruch erhoben werden, sowohl gegen das „Ob“ der Anordnung (der Widersprechende will erreichen, dass alle oder einzelne der zur Verlesung vorgesehenen Urkunden förmlich verlesen werden) als auch gegen das „Wie“ ihrer Durchführung (z. B. die unvollständige oder missverständliche Beschreibung zu lesender Dokumententeile). Ist ein Angeklagter der deutschen Sprache oder überhaupt des Lesens unkundig, kann eine Person zur Übersetzung oder zum Vorlesen eingesetzt werden. Die Schöffen entscheiden über den Widerspruch mit. Bei den Rechtsfragen werden sie eher wenig zur Entscheidung beitragen können (ob etwa der Nebenkläger widerspruchsbefugt ist); aber bei der Frage, ob die Anordnung des Vorsitzenden eindeutig und verständlich ist, kann ihre Beteiligung wertvolle Erkenntnisse liefern. So hat der BGH die einschränkende Definition eines Vorsitzenden zum Umfang der selbst zu lesenden Dokumente beanstandet: „Soweit (…) Urkunden (…) in fremder Sprache abgefasst sind, sind nur (…) nicht sprachspezifische[n] Angaben Gegenstand des Selbstleseverfahrens“ und schriftliche Erklärungen nur insoweit, „als dies durch § 256 Abs. 1 Nr. 1, 5 StPO gestattet wird“. Diese abstrakte Einschränkung des Selbstleseumfangs durch rechtliche („durch § 256 Abs. 1 Nr. 1, 5 StPO gestattet“) und tatsächliche Kriterien („nicht sprachspezifische Angaben“) könnten die zum Beweis eingeführten Urkunden(teile) nicht eindeutig identifizieren und individualisieren.9
Bloß theoretisch ist der Einwand, durch das Selbstlesen entfalle die Eindrücklichkeit des mündlich Vorgetragenen. Die wenigsten Richter haben einen Sprechunterricht absolviert, bei dem der Text durch die Sprache Gestalt annimmt und Schlüsse zuließe, ob eine Passage für richtig und wichtig oder eher als zu vernachlässigen oder fehlerhaft erachtet wird. Ich musste während längeren Verlesens von Dokumenten schon mahnen: „Herr Vorsitzender, ich höre Sie wohl, aber ich verstehe Sie nicht.“ Zu Recht weist Zieschang in einem Beitrag deshalb darauf hin, dass eigenes Lesen – zu einem individuell gewählten Zeitpunkt – besser geeignet ist, gerade umfangreiche Inhalte zu verinnerlichen, indem Texte verglichen, markiert oder wiederholt gelesen werden können.10
3. Abschluss und Protokollierung des Selbstleseverfahrens
§ 249 Abs. 2 StPO verlangt, dass „die Richter und Schöffen vom Wortlaut der Urkunde Kenntnis genommen haben“. Die Schöffen müssen nach Ablauf der Frist, die zum Lesen zur Verfügung steht, zum Protokoll der Hauptverhandlung versichern, dass sie die Dokumente tatsächlich gelesen haben. Wie sie dies bewerkstelligen, z. B. über 9.000 Seiten „verschriftete und übersetzte Gespräche aus der Telefonüberwachung und Textnachrichten, Vermerke von Polizeibeamten, Durchsuchungs- und Beschlagnahmeprotokolle niederländischer Behörden, fremdsprachige Gesprächsprotokolle, Observationsberichte, behördliche Gutachten mit Lichtbildern sowie Urteilsabschriften11 zu lesen, zu verstehen und auf ihre Beweiserheblichkeit zu prüfen, ist ihnen überlassen. Wichtig ist nur, dass sie die Texte gelesen und verstanden haben.
Die Versicherung, die Beweisunterlagen gelesen zu haben, beendet das Selbstleseverfahren. Damit sind die durch die Anordnung bezeichneten Unterlagen ordnungsgemäß als Beweismittel in das Verfahren genauso eingeführt, als wenn sie verlesen worden wären. Gibt ein Schöffe wahrheitswidrig zu Protokoll, alle entscheidungserheblichen Schriftstücke gelesen zu haben, stellt dies eine Verletzung der Amtspflichten dar, die zur Amtsenthebung führen kann. Die Verteidigung hat jedoch kaum Möglichkeiten, Zweifel daran in das Verfahren einzuführen, dass alle Mitglieder des Gerichts – insbesondere die Schöffen – die Unterlagen vollständig gelesen haben. Fragen an die Schöffen, ob sie die Akten tatsächlich gelesen haben, oder gar eine schriftliche Versicherung von ihnen zu verlangen, ist unzulässig. Generell müssen sich Richter nicht dazu erklären, ob sie den gesamten Beweisstoff der Hauptverhandlung aufgenommen haben.12 Ob die Richter (Schöffen) die Urkunden tatsächlich zur Kenntnis genommen haben, bleibt daher für die Beteiligten im Dunkel.
Allerdings kann die Verteidigung die sog. Unmöglichkeitsrüge erheben, wenn sich aufgrund bestimmter, leicht feststellbarer äußerer Umstände die Schlussfolgerung ergibt, dass die Schöffen die überlassenen Urkunden in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht gelesen haben können. Eine solche Unmöglichkeit ist z. B. in einem Verfahren mit Selbstleseakten von über 9.000 Blatt nicht erhoben worden, für die in der Zeit vom 3. Juli bis zum 8. Januar des Folgejahres 188 Tage zur Verfügung standen,13 obwohl sich Zweifel durch eine einfache Rechnung (und ggf. Kontrolle) aufgedrängt hätten. Im Schnitt hätten die Schöffen rund 50 Seiten pro Tag (Sonn- und Feiertage zum Jahresende inklusive) lesen, verstehen und einordnen müssen. Für diese aufgewendete Zeit sind die Schöffen zu entschädigen. Der oft von Geschäfts- oder der Anweisungsstelle zu hörende Einwand, die Schöffen würden die Akten in ihrer Freizeit lesen, geht fehl, da die aufgewendete Zeit entschädigt wird, gleichgültig ob in Arbeits- oder Freizeit. Wenn für die 50 Seiten jeweils 3 Stunden in Ansatz gebracht werden (die letzte angefangene Stunde pro Tag wird voll gerechnet, § 15 Abs. 2 JVEG), beläuft sich allein die Zeitentschädigung (7 €/Std.) für jeden Schöffen auf über 3.500 €. Damit ist der Entschädigungsbeleg der Gerichtskasse nicht nur ein Rechnungs-, sondern wäre auch ein Beweismittel für die Verteidigung.
III. Schlussfolgerungen und Reformbedarf
Die Entwicklung des Selbstleseverfahrens bringt über ihren bloßen Beweiswert Grundsätze der langjährigen Rechtsprechung zum Prozessrecht in Bezug auf Schöffen ins Wanken. Die Auffassung, Schöffen dürften keine Akteneinsicht nehmen, insbesondere das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen aus der Anklageschrift nicht bekommen, ist nicht mehr haltbar. Der Gesetzgeber hat die Aktenkenntnis im Selbstleseverfahren vorgeschrieben; dafür ist der jederzeitige Zugriff auf die vollständige Anklageschrift unentbehrlich. Warum in anderen Fällen die Aktenkenntnis wegen einer möglichen Beeinflussung der Schöffen unzulässig sein soll, ist nicht nachvollziehbar. Da die Schöffen auf die Sitzungstage ausgelost und nicht für umfängliche Verfahren besonders ausgewählt werden, sind sie in allen Verfahren hinsichtlich der Gefahr einer evtl. Beeinflussung durch Kenntnisse aus den Akten gleich einzuschätzen. Eine Differenzierung aufgrund der Art des Verfahrens ist nicht sachgerecht, da der Vorwurf einer Befangenheit die Persönlichkeit des Schöffen betrifft. Dass Nichtjuristen sich vom schriftlichen Anklagevorwurf der Staatsanwaltschaft beeindrucken oder beeinflussen lassen, Juristen hiervon aber frei seien, ist eine der vielen Legenden, die Juristen über sich verbreiten, die durch Studium und praktische Ausbildung im Referendariat nicht gedeckt wird. Der BGH hat daher bereits 1997 zu Recht entschieden, es widerspreche grundsätzlich der gebotenen Gleichstellung zwischen Schöffen und Berufsrichtern (§ 30 Abs. 1 GVG), die Schöffen von jeglicher unmittelbaren Kenntnisnahme der Akten auszuschließen. Die Zulässigkeit der Überlassung der Anklageschrift (mit wesentlichem Ergebnis der Ermittlungen) hat der EGMR klargestellt.14
Ein Problem für die Schöffen ist das Fehlen einer eindeutigen Regelung zur Freistellung von ihrer beruflichen Tätigkeit für die Zeit des Selbstlesens. Diese greift nach bisherigem Verständnis des Anspruches auf Freistellung nach § 45 Abs. 1a Satz 2 DRiG nur dann, wenn die Schöffen zum Aktenstudium ins Gericht bestellt oder dieses an einem Hauptverhandlungstag vornehmen würden – was regelmäßig nicht geschieht. Das Aktenstudium wird somit in der „Freizeit“ der Schöffen durchgeführt. In der Literatur wird zur Lösung der Vorschlag gemacht, in das DRiG einen Anspruch auf angemessene Freistellung für das Selbstleseverfahren einzufügen.15 Jedoch bleibt die Sorge, dass bei einem ernsthaften Verfolgen dieses Vorschlages eine Initiative zur Abschaffung der Schöffen in Umfangsverfahren nicht lange auf sich warten lässt. Bei einer Abwägung zwischen Ökonomie und Demokratie in der Justiz hat in den letzten Jahrzehnten noch allemal die Ökonomie gesiegt.
- BGBl. I 1978, S. 1645. ↩︎
- BGBl. I 1987, S. 475; ein ausdrücklicher Verzicht auf die Verlesung seitens des Staatsanwalts, Verteidigers bzw. Angeklagten ist nicht mehr erforderlich; der wesentliche Inhalt der Urkunde muss vom Gericht nicht mehr mitgeteilt werden. ↩︎
- BGBl. I 1994, S. 3186; Erweiterung auf Vernehmungsprotokolle und selbstverfasste Erklärungen von Zeugen, Sachverständigen oder Mitbeschuldigten (§ 251 StPO) sowie auf den Katalog der in § 256 StPO genannten Dokumente, wie z. B. ärztliche Atteste. ↩︎
- BGBl. I 2017, S. 2208; Ausdehnung auf verlesbare elektronische Dokumente. ↩︎
- Vgl. BGH, Beschluss vom 9.11.2017, Az.: 1 StR 554/16, RohR 2018, S. 105 (Umfang von 12.000 Blatt). ↩︎
- BGH, Beschluss vom 14.11.2024, Az.: 3 StR 289/23, LAIKOS Journal online 2025, S. 21 f. mit Anm. Lieber. ↩︎
- Hartmut Schneider, Grundlegende sowie aktuelle Fragen zum Selbstleseverfahren, Teil 2, NStZ 2022, S. 338, 339 m. w. N. in Fn. 23. ↩︎
- Vgl. Nr. 126 Abs. 3 RiStBV. ↩︎
- BGH, Beschluss vom 8.2.2022, Az.: 5 StR 243/21, LAIKOS Journal online 2023, S. 72 mit Anm. Lieber. ↩︎
- Frank Zieschang, Das Selbstleseverfahren – sinnvoll oder gesetzliche Fehlleistung?, ZflStw 2025, S. 38, 40 [Abruf: 1.9.2025]. ↩︎
- So BGH, Beschluss vom 14.11.2024, Az.: 3 StR 289/23, LAIKOS Journal online 2025, S. 21 f. mit Anm. Lieber. ↩︎
- Hartmut Schneider, Grundlegende sowie aktuelle Fragen zum Selbstleseverfahren, Teil 2, NStZ 2022, S. 338, 442. ↩︎
- BGH, Beschluss vom 8.2.2022, Az.: 5 StR 243/21, LAIKOS Journal online 2023, S. 72 mit Anm. Lieber. ↩︎
- Urteil vom 12.6.2008, Az.: 26771/03; ausführlich zur Aktenkenntnis der Schöffen: Lieber/Sens, Fit fürs Schöffenamt, 3. Aufl., 2024, S. 189 ff. ↩︎
- Mirja Feldmann, Transparenz statt Mündlichkeit, Konzentration von Verhandlungsstoff statt von Verhandlungstagen!, wistra 2020, S. 1, 8 f. ↩︎
Zitiervorschlag: Hasso Lieber, Das Selbstleseverfahren – Was Schöffen wissen sollten, in: LAIKOS Journal Online 3 (2025) Ausg. 2, S. 44-47.