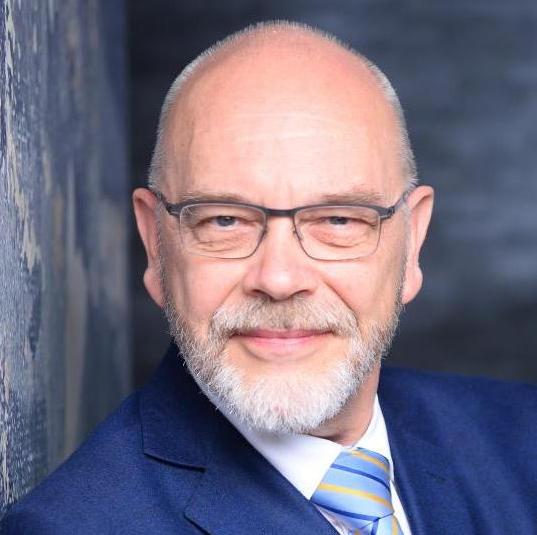M. Zeh: Moral und Strafe
Marco Zeh: Moral und Strafe. Warum wir nicht strafen dürfen. Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges. 2024. 279 S. (Nomos-Universitätsschriften: Philosophie; Bd. 4) Print-Ausg.: ISBN 978-3-7560-1849-9 € 69,00; E-Book € 69,00
Der Autor unterzieht die Strafe einer grundlegenden Untersuchung über Sinn, Zweck, Begründung (kurz: ihre Rechtfertigung) und mögliche Alternativen. Zunächst untersucht er den Begriff auf seine Bedeutung und entwickelt über die gängige kurze Definition „Strafe ist die absichtliche Zufügung eines Übels“ hinaus eine Definition mit mehreren Merkmalen auf die Beteiligten: „Strafe ist eine gewünschte Übelzufügung, die jemand einem empfindenden Wesen in Reaktion auf eine schuldhafte Normverletzung zufügt, wobei die Strafe für den Bestraften tatsächlich ein Übel darstellen muss. Strafe ist von Wiedergutmachung zu unterscheiden.“ Strafe kennt also mehrere Beteiligte mit zielgerichtetem Handeln und der Übereinstimmung von Wollen und Erfolg. Dass die in der Strafenhierarchie mildere Sanktion der Geldstrafe in der Praxis bei einem Mittellosen härtere Auswirkungen hat als die (rechtstheoretisch) schwerere Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird, ist nachvollziehbar, in der Praxis aber nicht unbedingt und immer jedem Justizbeschäftigten gegenwärtig. Die gewandelte Auffassung von Strafe schlägt sich z. B in der Abschaffung der Körper-, Leibes- und Todesstrafe nieder.
Der deutsche Gesetzgeber des 20. Jahrhunderts hat mit der Aussetzung der Vollstreckung der Freiheitsstrafe zur Bewährung eine zunehmende Differenzierung auch dieser Strafe geschaffen. Die Ergänzung der Strafe um die Maßregeln der Besserung und Sicherung stellte einen Fortschritt in Richtung der Rehabilitation und Prävention dar. Mit der Rechtfertigung der Strafe durch die verschiedenen Straftheorien (Sühne, Vergeltung, Resozialisierung, Prävention, Sicherung, Genugtuung, Wiedergutmachung) und ihrer Umsetzung im Strafrecht befasst sich die Arbeit in ihrem zweiten Teil.
Die kritische Darstellung führt zwangsläufig zur Frage nach Alternativen, die im dritten Teil abgehandelt werden. Diese handelt der Autor an einem fiktiven, aber typischen „Fall Thomas F.“ ab. Die Reaktionsmöglichkeiten beginnt er mit Früherkennung und Prävention, wobei die gesellschaftliche Mitwirkung gefragt ist. Ergänzend möchte man hinzufügen, dass auch Rechts- und Sozialpolitik ergänzend zum „Ich“ (habe ein Recht) das von Verantwortung geprägte Element „Wir“ (berücksichtigen die Schnittstellen zum Recht der anderen) stärker in Gesetz und Vollzug einbeziehen müssen. In der zweiten Stufe wird die Wiedergutmachung des angerichteten Schadens als ausgleichende Funktion herangezogen. Bei gravierenderen Fällen sollen resozialisierende Maßnahmen zentraler Bestandteil der staatlichen Reaktion sein. Unter den elf genannten Beispielen befinden sich die Betreuung durch einen Fallmanager (den das geltende Recht in Form des Bewährungshelfers kennt), die Unterbringung in einer Wohngemeinschaft, die Verpflichtung einer Aus- oder Weiterbildung, einer Psychotherapie usw. Auf der letzten Stufe sieht Zeh die „Sicherung“ des Täters vor, um ihn durch Isolierung (ggf. durch eine elektronische Fußfessel) von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten.
Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen lassen sich mit dem geltenden Recht verwirklichen, bedürfen also nicht notwendig einer neuen Initiative des Gesetzgebers. Insofern ist die Arbeit keine bloß perspektivisch-theoretische Entwicklung neuer Maßnahmen anstelle von Strafverfahren und -vollzug, sondern eher eine Mahnung an die Praxis, mit einem differenzierteren Verständnis des Strafbegriffs und seiner Zielsetzung die vorhandenen Mittel einzusetzen, um der immer noch vorhandenen archaischen Auffassung von Strafe entgegenzuwirken. (hl)
Zitiervorschlag: Hasso Lieber, M. Zeh: Moral und Strafe [Rezension], in: LAIKOS Journal Online 3 (2025) Ausg. 2, S. 75-76.