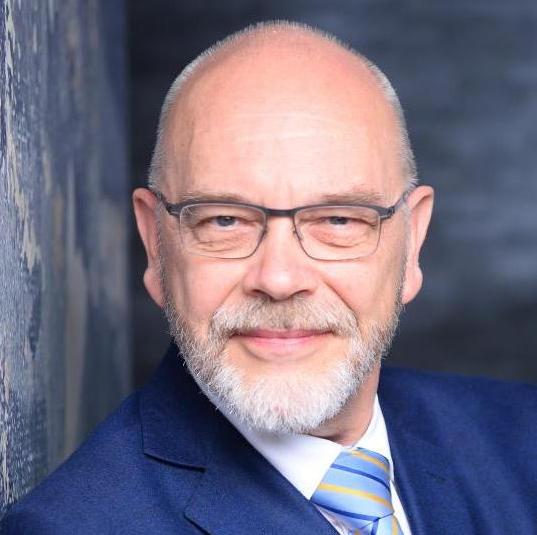A. Herrmann: Tatrichterliche Beurteilungsspielräume im materiellen Strafrecht
Alina Herrmann: Tatrichterliche Beurteilungsspielräume im materiellen Strafrecht. Eine dogmatische und rechtstheoretische Untersuchung zur Revisibilität der tatrichterlichen Rechtsanwendung in Fällen unbestimmter Tatbestandsmerkmale. Berlin: Duncker & Humblot 2025. 234 S. (Strafrechtliche Abhandlungen; N. F. Bd. 327) Print-Ausg.: ISBN 978-3-428-19316-5 € 79,90; E-Book: € 79,90
Die Revision besteht in der Kontrolle des tatrichterlichen Urteils auf fehlerhafte Anwendung des Rechts. Der Umfang der Prüfung ist unterschiedlich. Für Tatsachenfeststellung, Beweiswürdigung und Ermessen des Tatrichters gelten beschränkte Prüfungsmaßstäbe. Das Revisionsgericht kann etwa bei der Beurteilung der Glaubhaftigkeit einer Zeugenaussage seine Wertung nicht an die Stelle des Tatrichters setzen. Das Revisionsgericht prüft insoweit nur die Vertretbarkeit des angegriffenen Urteils. Die Urteilsgründe müssen in Bezug auf diese Feststellungen logisch, vor allem widerspruchsfrei sein. Uneinigkeit besteht jedoch darüber, inwieweit diese Prüfung bei unbestimmten Tatbestandsmerkmalen geht, also Begriffen, zu denen das Gesetz selbst keine Definition gibt; bei deren Anwendung entscheiden Umstände des Einzelfalls, ob das Merkmal vorliegt oder nicht. Im ersten Kapitel untersucht die Autorin, welche Spielräume zur Beurteilung der Merkmale die Revisionsrechtsprechung dem Tatrichter gibt. Den größten Raum hat er bei der Strafzumessung, weil diese auf vielen individuellen Umständen des unmittelbaren Eindrucks von der Täterpersönlichkeit beruht. Hier stößt die rein rechtliche Betrachtung an ihre Grenzen. Das Strafmaß ist grundsätzlich „Sache des Tatrichters“. Das Gleiche gilt für die Anwendbarkeit des Jugendstrafrechts bei Heranwachsenden. Auch in Abgrenzungsfällen zwischen Täterschaft und Teilnahme, zwischen Tun und Unterlassen von der bloßen (straflosen) Vorbereitung einer Straftat oder auch wertenden Tatbestandsmerkmalen wie dem „auffälligen Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung“ beim Wucher bestehen weite Spielräume. In gewisser Hinsicht muss sich auch der (in der Schrift nicht erwähnte) Schöffe mit solchen Fragen befassen, etwa bei der Abgrenzung zwischen bewusster Fahrlässigkeit (gefährlich, aber es wird schon nichts passieren) und bedingtem Vorsatz (ich will zwar nicht, aber wenn es schiefgeht, nehme ich das in Kauf). Die Bedeutung für den Tatrichter liegt darin, dass er im Bewusstsein eines großen, nur beschränkt überprüfbaren Spielraums sein Urteil fällt, woraus die Pflicht zu sorgfältiger Beweisfeststellung wie Begründung folgt – für Schöffen wie Berufsrichter. Dabei stellt sich oft die Frage, inwieweit intuitive Einflüsse auf die jeweilige Entscheidung so eng mit dem unmittelbaren Eindruck aus der Hauptverhandlung verknüpft sind, dass eine umfassende revisionsgerichtliche Kontrolle aus rein faktischen Gründen ausscheidet. Dem Schöffen sollte diese Fragestellung vor Augen führen, dass die Urteilsfindung deutlich mehr ist als nur die Umsetzung des Gesetzes auf ein reales Geschehen. Man kann darin auch ein Plädoyer gegen die einzelrichterliche Entscheidung sehen. In der Schlussbetrachtung resümiert die Autorin, dass die Feststellung der Schuld stets eine rationale und tragfähige Entscheidungsbegründung verlangt, die sich keinesfalls allein auf ein nicht näher kommunizierbares Judiz des Tatrichters stützen darf. Im Hinblick auf die Schöffen ist zu ergänzen, dass das vielzitierte „Bauchgefühl“ durch rationale Argumente und logische Schlussfolgerungen zu untermauern ist und Schöffen hierzu in der Lage sein müssen. Die Dissertation regt den Leser insoweit zu einer Reihe weiterführender Schlussfolgerungen an. Auch wenn die herrschende Meinung inzwischen der Revisionsrechtsprechung neben der Wahrung der Rechtseinheit auch die Einzelfallgerechtigkeit als Aufgabe zuweist, muss der Tatrichter mit der Erkenntnis leben, dass die letztere im Wesentlichen dem Richter obliegt, der dem Angeklagten ins Auge sieht. Für Fragestellungen, die sich im Grenzbereich zwischen Tatsachenfeststellung und rechtlicher Würdigung befinden, akzeptiert die Autorin die ausnahmsweise Verschiebung der Letztentscheidungskompetenz auf die Ebene der Tatgerichte. (hl)
Zitiervorschlag: Hasso Lieber, A. Herrmann: Tatrichterliche Beurteilungsspielräume im materiellen Strafrecht [Rezension], in: LAIKOS Journal Online 1 (2025) Ausg. 1, S. 34-35.