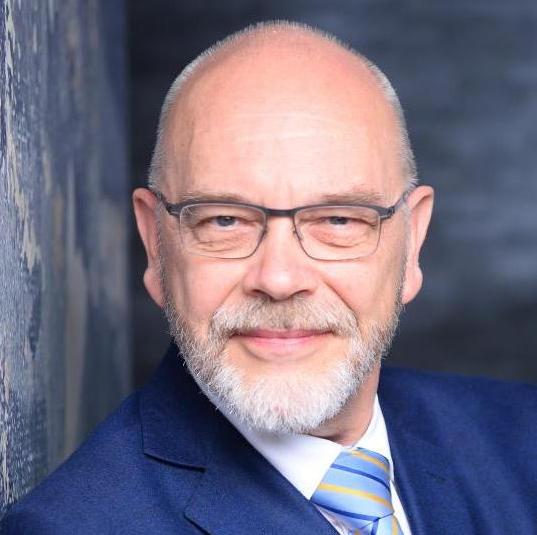Das Bundesverfassungsgericht zum Recht auf ein faires Verfahren
Hasso Lieber
Abstract
Mit der Verfassungsbeschwerde macht ein in Abwesenheit rechtskräftig Verurteilter die Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren geltend, weil das Berufungsgericht in seine verfassungsmäßig garantierten Rechte auf rechtliches Gehör und Verteidigung eingegriffen habe.
With the constitutional complaint, a person who has been convicted in absentia asserts a violation of the right to a fair trial because the court of appeal interfered with his constitutionally guaranteed rights to a fair hearing and defence.
Rechtsquellen des „Fairen Verfahrens“
Nach Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) hat „jede Person (…) ein Recht darauf, dass (…) über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage (…) in einem fairen Verfahren (…) verhandelt wird“. Das Grundgesetz beinhaltet dieses Recht im Zusammenwirken des Rechtsstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 3) mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2) und der Garantie der Menschenwürde (Art. 1). Zur Fairness im Strafprozess gehört, dass der Angeklagte nicht bloßes Objekt des Verfahrens ist, sondern die prozessualen Möglichkeiten und Rechte selbstständig wahrnehmen und den dazu erforderlichen Sachverstand eines Verteidigers heranziehen kann. Im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde führt das BVerfG die Regel Berufsrichtern wie Schöffen deutlich vor Augen.1
Das Ausgangsverfahren bis zur Verfassungsbeschwerde
Ein Angeklagter (A.) war durch zwei amtsgerichtliche Urteile am 3.3.2023 (wegen Körperverletzung und Bedrohung zu Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 10,00 €) und 17.3.2023 (wegen versuchter Körperverletzung in besonders schwerem Fall zu 150 Tagessätzen à 40,00 €) verurteilt worden. Gegen beide Urteile legten Staatsanwaltschaft (StA) und A. Berufung ein. Zwei Tage vor der Verhandlung vom 13.9.2023 teilte der Verteidiger mit, A. sei verhandlungsunfähig erkrankt; ein Attest werde nachgereicht. Das LG hielt an dem Termin fest, zu dem A. und der Verteidiger nicht erschienen. Die Berufungen des A. wurden wegen dessen Abwesenheit verworfen (§ 329 Abs. 1 StPO). Die StA hatte die Berufung gegen das erste Urteil zurückgenommen; verhandelt wurde dann nur noch über die Berufung der StA gegen das Urteil vom 17.3.2023. A. wurde in Abänderung der rechtlichen Würdigung wegen Störung des öffentlichen Friedens, versuchter Nötigung und Bedrohung unter Einbeziehung zweier früherer Verurteilungen zur Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Revision des Angeklagten verwarf das OLG am 15.5.2024. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wurde begonnen. A. legte Verfassungsbeschwerde ein, verbunden mit dem Antrag auf eine einstweilige Anordnung, die Vollstreckung der Freiheitsstrafe vorläufig auszusetzen. Die Verfassungsbeschwerde stützt A. darauf, dass die Verurteilung in seiner Abwesenheit ohne Mitwirkung des Verteidigers sein Recht auf ein faires Verfahren verletze.
Das BVerfG hat die Vollstreckung der Freiheitsstrafe durch Beschluss vom 19.7.2024 einstweilen ausgesetzt, weil die Verurteilung den A. in seinem Recht auf ein faires Verfahren verletzen könne, wenn das Urteil trotz der zu erwartenden gravierenden Rechtsfolgen ohne Mitwirkung eines notwendigen Verteidigers ergangen ist. Dieses Recht gehöre zu den wesentlichen Grundsätzen des rechtsstaatlichen Verfahrens. Es gewährleiste dem Beschuldigten unverzichtbar, prozessuale Rechte und Möglichkeiten mit der erforderlichen Sachkunde wahrzunehmen, um Übergriffe staatlicher Stellen oder anderer Verfahrensbeteiligter angemessen abwehren zu können. Die Regeln zur notwendigen Verteidigung konkretisierten das Gebot eines fairen Verfahrens. Zur Verfassungskonformität des Urteils in der Sache muss binnen sechs Monaten entschieden werden. Am 14.1.2025 hat das BVerfG die Aussetzung für weitere sechs Monate wiederholt.
Gründe der Entscheidung des BVerfG
Beim Ausbleiben eines Angeklagten ohne genügende Entschuldigung weist § 329 Abs. 1 Satz 1 StPO zwar das Gericht an, die Berufung zu verwerfen („hat das Gericht eine Berufung […] zu verwerfen“). Allerdings ist Voraussetzung, dass sich der Angeklagte „vorsätzlich und schuldhaft“ in den die Verhandlungsfähigkeit ausschließenden Zustand versetzt hat, wozu die Kammer nach Abs. 1 Satz 3 einen Arzt anzuhören hätte2 bzw. – wenn nach Ansicht des Gerichts die Erkrankung nur taktischer Natur war – die Vorführung oder Verhaftung vor dem nächsten Termin anordnen müssen (Abs. 4). Letzteres ist aber nur erforderlich, wenn es sich bei dem Verfahren um den Fall einer notwendigen Verteidigung handelt. Diese drängt sich nach § 140 Abs. 2 StPO auf, wenn die Sach- oder Rechtslage schwierig ist oder der Beschuldigte sich nicht selbst verteidigen kann. Über diese zentrale Frage, ob ein Verteidiger erforderlich war, hat das BVerfG noch zu entscheiden. Das Ergebnis liegt so nahe, dass der Senat die weitere Vollstreckung der Haft ausgesetzt (§ 32 Abs. 1 BVerfGG) und einmal verlängert hat. Es spricht viel dafür, dass die Verurteilung ohne Verteidiger in der Berufungshauptverhandlung das Recht des Bf. auf ein faires Verfahren verletzt.
Bedeutung der Entscheidung für Schöffen
Weil das Verfahren so eklatant gegen Grundsätze verstößt, die jedermann geläufig sein sollten, wie der Anspruch auf rechtliches Gehör oder das Recht auf Verteidigung, interessiert die Rolle der Schöffen in der Berufungskammer, ohne deren Zustimmung das Urteil weder im Wechsel von der Geld- zur Freiheitsstrafe noch in der Höhe oder der Frage der Strafaussetzung zur Bewährung zustande kommen konnte. Bei der Besetzung der Kleinen Strafkammer (ein Berufsrichter, zwei Schöffen) wäre auch die Verwerfung der Berufung wegen Abwesenheit des Angeklagten als Verfahrensentscheidung gegen beide Schöffen nicht möglich gewesen. Die Schöffen trifft die Verantwortung für die gesamte Entscheidung. Es bedarf keines Jura-Studiums zur Beurteilung der Frage, ob es gerecht und angemessen ist, eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren zu verhängen, ohne dass das Gericht sich einen persönlichen Eindruck vom Angeklagten in Anwesenheit seines Verteidigers verschafft hat. Der Sprung von 180 Tagessätzen Geldstrafe auf zwei Jahre zu vollstreckender Freiheitsstrafe sollte auch dann (oder gerade) Überlegungen auslösen, den Angeklagten dazu zu hören, wenn neben der anderen Geldstrafe noch eine weitere Verurteilung einzubeziehen war. Die beiden Strafrichter waren offenkundig jeweils der Ansicht, dass die Geldstrafe den A. von weiteren Taten abhalten würde.
Wenn die Urteile so drastisch geändert werden, ist es eine Frage der Fairness, den Angeklagten dazu zu hören und ihm dazu qualifizierten Beistand zu gewähren. Das Beratungsgeheimnis versperrt uns die Kenntnis darüber, ob der Vorsitzende der Kleinen Strafkammer die Schöffen umfassend über die Möglichkeiten des Verfahrens aufgeklärt hat – und ob die Schöffen hierzu überhaupt nachgefragt haben.3 Schöffen haben das Recht zu fragen, alternativ zu denken und andere Meinungen zu entwickeln, wo die Bereitschaft bei den Juristen hinter der Alltäglichkeit der Fälle und der Zahl der Verfahren verschwindet. Kritisch nachzufragen, ob es unbedingt notwendig ist, diesen Sprung zu tun, ohne den Betroffenen zu hören, ist für die Schöffen keine Frage juristischen Wissens, sondern des Charakters. Genau diese Fälle sind es, die das richterliche Ehrenamt mit seiner Unabhängigkeit von Beurteilung, Beförderung, Besoldung und Kollegialität unentbehrlich machen.
Das BVerfG hat in wohlgesetzten, aber nicht minder deutlichen Worten formuliert, was das so oft zitierte „Rechtsgefühl aller billig und gerecht Denkenden“ ebenfalls ausgedrückt hätte. Von der Macht, über die Freiheit von Menschen zu entscheiden, ist fair Gebrauch zu machen, selbst wenn der Angeklagte (oder sein Verteidiger) ein Unsympath sein sollte, der das Gericht austricksen will.
Eine Bemerkung zum Schluss: Die Justiz klagt permanent über ihre Überlastung. Warum dann nicht Vorsorge getroffen wird, dass StA wie AG die Information zweier so dicht liegender Anklagen bei einem AG und seiner Nebenstelle haben, damit die Taten entweder gemeinsam angeklagt oder die angeklagten Verfahren verbunden werden (Stichwort Digitalisierung), erschließt sich nicht. Insofern ist moderne Technik auch ein Faktor der Gerechtigkeit.
- Beschluss vom 19.7.2024, Az.: 2 BvR 829/24 [Abruf: 24.4.2025]. ↩︎
- Andreas Quentin, in: Münchener Kommentar zur StPO, Bd. 2, 2. Aufl., 2024, § 329 Rn. 59. ↩︎
- Die Schöffen können sich auch nicht darauf berufen, dass ein OLG-Senat das LG-Urteil abgenickt hat. Aus Sicht des OLG hatte die Revisionsbegründung offensichtlich formale Fehler, die zur Abweisung der Revision führte, deren Bewertung vom BVerfG in seiner Entscheidung aber als „überspannt“ bezeichnet wurden. Auch das OLG war nicht gehindert, sich zum „Fairen Verfahren“ Gedanken zu machen. ↩︎
Zitiervorschlag: Hasso Lieber, Das Bundesverfassungsgericht zum Recht auf ein faires Verfahren, in: LAIKOS Journal Online 3 (2025) Ausg. 1, S. 17-18.