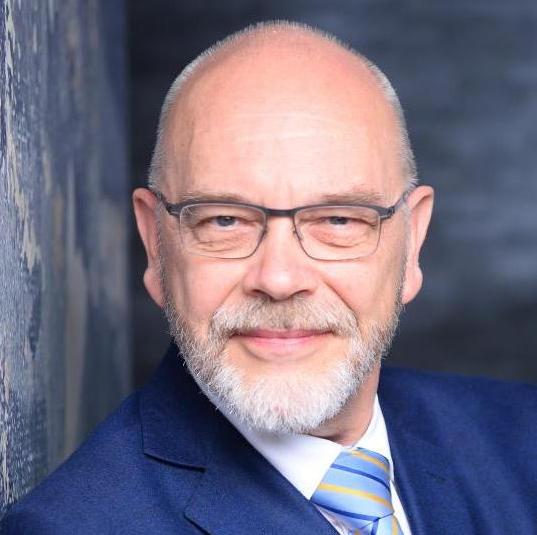Die Kompetenz der Länder bei der Besetzung der Gerichte
Hasso Lieber
Abstract
Das Bundesrecht bestimmt die Besetzung der Gerichte, gibt aber in einigen Bereichen Gestaltungsmöglichkeiten durch Landesrecht. So können in der Verwaltungs- und der Finanzgerichtsbarkeit ehrenamtliche Richter über das Bundesrecht hinaus mitwirken.
Federal law determines the composition of the courts, but in some areas allows for flexibility through law by the Länder. For example, in administrative and fiscal jurisdiction, honorary judges may participate beyond the scope of federal law.
Vorbemerkung
Die Gerichtsverfassung unterfällt der konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG). In deren Rahmen ist die Besetzung der Spruchkörper durchgehend vom Bundesrecht geregelt. Der Gesetzgeber schafft aber partiell mit Öffnungsklauseln Gestaltungsspielräume für die Gesetzgebung der Länder. Für diese ist es eine politische wie rechtliche, häufig auch fiskalische Frage, ob sie von der jeweiligen Möglichkeit Gebrauch machen (wollen). Im Folgenden werden zwei Gerichtsbarkeiten betrachtet, in denen der Bundesgesetzgeber den Ländern Spielraum für die Beteiligung ehrenamtlicher Richter gibt: in der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und der Finanzgerichtsordnung (FGO).
1. Allgemeine Verwaltungsgerichtsbarkeit
Das Oberverwaltungsgericht (OVG) – Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen – ist zweite Instanz gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts. Als erste Instanz ist es zuständig für Streitigkeiten in bestimmten zentralen Rechtsgebieten (z. B. Landes- und Verkehrsplanung, Energiewirtschaft, vgl. § 48 Abs. 1 VwGO), im sog. Normenkontrollverfahren (§ 47 VwGO) zur Entscheidung über die Gültigkeit von Satzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB), von Rechtsverordnungen nach § 246 BauGB sowie von anderen untergesetzlichen Rechtsvorschriften, sofern das Landesrecht dies bestimmt.
Die Spruchkörper (Senate) entscheiden in beiden Instanzen im Grundsatz in der Besetzung von drei Berufsrichtern (§ 9 Abs. 3 VwGO). Durch Landesrecht kann die Besetzung auf fünf Richter erweitert werden, zwei davon können ehrenamtliche Richter sein; für die erstinstanzlichen Verfahren nach § 48 VwGO kann das Landesrecht vorsehen, dass die Senate mit fünf Richtern plus zwei ehrenamtlichen Richtern entscheiden. Von den Ermächtigungen in Bezug auf die Beteiligung ehrenamtlicher Richter haben die Länder unterschiedlich Gebrauch gemacht:1
a. Ohne Beteiligung ehrenamtlicher Richter:
Zweite Instanz mit drei Berufsrichtern: Baden-Württemberg, Bayern, Saarland, Sachsen, Thüringen.
Normenkontrolle (§ 47 VwGO) mit fünf Berufsrichtern: Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen.
b. Erste Instanz (§ 48 Abs. 1 VwGO) mit fünf Berufs- und zwei ehrenamtlichen Richtern:
Brandenburg: § 4 Abs. 3 BbgVwGO
Bremen: Art. 2 Abs. 2 AGVwGO
Hessen: § 13 Abs. 1 AGVwGO
Nordrhein-Westfalen: § 10 Abs. 3 AGVwGO.
c. Zweite Instanz mit drei Berufs- und zwei ehrenamtlichen Richtern:
Berlin/Brandenburg (Gemeinsames OVG): § 2 Abs. 1 Berliner AGVwGO bzw. § 4 Abs. 3 BbgVwGG
Bremen: Art. 2 Abs. 2 AGVwGO
Hamburg: § 3 AGVwGO
Hessen: § 17 Abs. 1 HessAGVwGO
Mecklenburg-Vorpommern: § 12 Abs. 1 Gesetz zur Ausführung des Gerichtsstrukturgesetzes (AGGerStrukG MV)
Niedersachsen: § 76 Abs. 1 Niedersächsisches Justizgesetz (NJG)
Nordrhein-Westfalen: § 109 Abs. 1 Gesetz über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen (JustG NRW)
Rheinland-Pfalz: § 2 Abs. 1 AGVwGO
Sachsen-Anhalt: § 4 Abs. 1 AG VwGO LSA
Schleswig-Holstein: § 66 Abs. 1 Landesjustizgesetz (LJG).
Unterschiedliche Auffassungen zwischen den Senaten in Fragen des Landesrechts entscheidet ein Großer Senat. Eine Beteiligung ehrenamtlicher Richter ist bereits bundesrechtlich nicht vorgesehen. Anregungen zur Erweiterung der Mitwirkung ehrenamtlicher Richter – auch in Normenkontrollverfahren – wird entgegengehalten, dass es in diesen Verfahren ausschließlich um Rechtsfragen gehe. Dahinter wird ein eingeschränktes Verständnis von der Funktion ehrenamtlicher Richter deutlich. „Vertreter des Volkes“ können auch über juristische Erfahrung und Kenntnisse verfügen. Sie sind vorrangig Vertreter der Zivilgesellschaft, die außerhalb der staatlichen Einflüsse und Beziehungen stehen, gerade in Instanzen, die Weichen für Rechtsanwendung und -auslegung stellen, in die sich die zivilgesellschaftliche Sicht einbringen kann. Dafür gibt es Beispiele in Landesverfassungsgerichten, in denen ehrenamtliche Richter – höchst erfolgreich – mit und ohne juristische Ausbildung mitwirken. Der Einfluss der Richterorganisationen auf Parlamente und Parteien ist aber immer noch groß genug, um die Exklusivität der Berufsjuristen zu erhalten.
2. Finanzgerichtsbarkeit
Der sich beständig erweiternden Zuständigkeit des Einzelrichters hat der Bundesgesetzgeber in § 5 Abs. 4 FGO für die – nur zweistufige – Finanzgerichtsbarkeit ein Korrektiv gegenübergestellt. Das jeweilige Landesrecht kann die Mitwirkung von zwei ehrenamtlichen Richtern an der Entscheidung des Einzelrichters in der mündlichen Verhandlung vorsehen. Lediglich Niedersachsen hatte mit § 3 Abs. 2 des niedersächsischen Ausführungsgesetzes zur FGO (AGFGO Nds.) von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und für Entscheidungen des Einzelrichters, die aufgrund mündlicher Verhandlung ergehen, die Beteiligung ehrenamtlicher Richter vorgesehen. Diesem Gesetz war jedoch keine lange Dauer beschieden; mit Gesetz vom 24.3.2006 wurde diese Beteiligung ersatzlos abgeschafft.2 Kein weiteres bundesdeutsches Land hat von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht. Die verfassungsrechtliche Debatte, wie weit die Beteiligung ehrenamtlicher Richter gehen kann, wenn sie – wie nach dieser Regelung – den einzigen Berufsrichter überstimmen können, macht die Angst des Juristen vor dem „Rest der Welt“ deutlich. Diese war schon nach der deutschen Vereinigung deutlich, als in der Verwaltungsgerichtsbarkeit die Kammern mit zwei Berufs- und drei ehrenamtlichen Richtern besetzt waren. Wenn zwei Berufsrichter nicht in der Lage sind, von drei ehrenamtlichen Richtern auch nur einen von ihrer Auffassung zu überzeugen, sollten sie nachdenken, woran das liegen könnte. Formal werden Bedenken aus Art. 108 Abs. 6 GG geltend gemacht, wonach „die Finanzgerichtsbarkeit (…) durch Bundesgesetz einheitlich geregelt“ wird. Aus Art. 92 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG wird abgeleitet, dass eine Mehrheit rechtsgelehrter Richter zumindest dort gegeben sein müsse, wo sich die Ausübung rechtsprechender Gewalt vornehmlich in Gesetzesauslegung und Gesetzesanwendung vollziehe. Hinter dem letztgenannten Argument steht die Vorstellung, ehrenamtliche Richter seien stets ohne jegliche Kenntnis vom Recht. Eine von beruflicher Erfahrung geprägte Sicht auf das Recht kann aber durchaus hilfreich sein. Man muss nur die Personen finden, die für die jeweilige Gerichtsbarkeit geeignet sind. Das Argument, die Beteiligung sei angesichts des immer komplizierter werdenden Steuerrechts fraglich, muss konsequent die Frage auslösen, welchen Stellenwert ein Recht hat, das nur von einer eingeschränkten Minderheit in der Bevölkerung verstanden werden kann. Weiter wird geltend gemacht, dass die Zweistufigkeit des finanzgerichtlichen Verfahrens – die de facto immer mehr zu einer Einstufigkeit geworden sei – eine Mehrheit gegenüber den Berufsrichtern in einem Spruchkörper nicht zulasse. Konkret heißt dieses Argument: Wir sparen an der Rechtsprechung zulasten der Demokratie. Abgerundet werden diese kritischen Bemerkungen durch den Gesetzgeber, der mit § 19 Nr. 5 FGO schon von Gesetzes wegen alle des Steuerrechts Kundigen (Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer usw.) vom Amt ausgeschlossen hat.
3. Inwieweit sind die Länder gehalten, den Ermächtigungen zu folgen?
Die Tatsache, dass derzeit kein Bundesland von der Ermächtigung des § 5 FGO Gebrauch macht und in der Verwaltungsgerichtsbarkeit fünf Bundesländer keine Beteiligung ehrenamtlicher Richter in OVG bzw. VGH vorsehen, wirft die Frage auf, ob die Länder tatsächlich völlig frei sind, partiell oder ganz eine Beteiligung auszuklammern. 12 von 16 Landesverfassungen enthalten eine Regelung zur Beteiligung ehrenamtlicher Richter aus der Zivilgesellschaft; danach sind „Männer und Frauen aus dem Volke [nach Maßgabe der Gesetze] an der Rechtsprechung zu beteiligen“.3 Im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung geben die Öffnungsklauseln in § 9 VwGO und § 5 FGO den Ländern die Kompetenz, in einem fest umrissenen Bereich die Besetzung von Spruchkörpern mit ehrenamtlichen Richtern zu regeln. Für die Frage, ob das Land von dieser Kompetenz Gebrauch macht, zwingen die 12 Landesverfassungen das jeweilige Landesparlament, in dem zustehenden Umfang ehrenamtliche Richter an der Rechtsprechung zu beteiligen. Diese Auffassung vertritt nahezu einhellig die Kommentarliteratur zu den betroffenen Landesverfassungen:
Bayern: Art. 88 BV normiert einen Verfassungsauftrag an den Gesetzgeber.4
Berlin: Die Bedeutung des Art. 79 Abs. 2 VvB liegt darin, dass der Landesgesetzgeber gezwungen ist, überall Laienrichter zuzulassen, wo das Bundesrecht diese Möglichkeit eröffnet. Die Verfassung hat eine grundsätzliche Entscheidung zugunsten des Einsatzes ehrenamtlicher Richter getroffen, z. B. für die zweite Instanz der Verwaltungsgerichtsbarkeit.5
Brandenburg: Die Landesverfassung bindet den Landesgesetzgeber dort, wo er durch Bundesrecht einen Ermessensspielraum hat. Die Landesverfassung zwingt den Gesetzgeber dazu, überall dort Laienrichter zuzulassen, wo das Bundesrecht dies zulässt.6
Bremen: Art. 135 Abs. 2 BremLV verfügt eine unbedingte Pflicht des Staates zur Heranziehung von Männern und Frauen aus dem Volke in der Rechtspflege.7
Sachsen: Dem Verfassungsauftrag nicht nachgekommen ist der Gesetzgeber im Fall des § 9 Abs. 3 VwGO, weil er – außerhalb der Fachsenate – ehrenamtliche Richter beim sächsischen OVG nicht vorgesehen hat. Es liegt nahe, ihn aus Art. 77 Abs. 3 SächsVerf verpflichtet zu halten, die Lücke zu schließen. Auch § 24 Abs. 2 Sächsisches Justizgesetz (zum Normenkontrollverfahren) ist nicht frei von verfassungsrechtlichen Bedenken, weil die bestehende Bindung an den Verfassungsauftrag des Art. 77 Abs. 3 übergangen wird.8
Es ist ein Phänomen, dass die Justiz zum einen im Zusammenspiel mit den anderen Staatsgewalten als Garant der Demokratie angesehen wird, andererseits innere demokratische Strukturen in der Justiz kaum Gegenstand der verfassungsrechtlichen bzw. -politischen Diskussion sind. Die Unabhängigkeit der Richter schützt vor Einflüssen von außen, nicht vor interner Beteiligung des Souveräns beim Zustandekommen der Entscheidungen.
- AGVwGO = Ausführungsgesetz zur VwGO, VwGG = Verwaltungsgerichtsgesetz des jeweiligen Landes. ↩︎
- Änderung des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zur Finanzgerichtsordnung: Gesetzentwurf, Drucksache / Niedersächsischer Landtag, 15/2380, Begründung: S. 20 f. [Abruf: 24.4.2025]; Nds. GVBl. 2006, S. 182. ↩︎
- Bayern Art. 88, Berlin Art. 79 Abs. 2, Brandenburg Art. 108 Abs. 2, Bremen Art. 135 Abs. 2, Hamburg Art. 62, Mecklenburg-Vorpommern Art. 76 Abs. 2, Niedersachsen Art. 51 Abs. 2, Nordrhein-Westfalen Art. 72 Abs. 2, Rheinland-Pfalz Art. 123 Abs. 1, Sachsen Art. 77 Abs. 3, Sachsen-Anhalt Art. 83 Abs. 1, Thüringen Art. 86 Abs. 3. ↩︎
- Heinrich Amadeus Wolff, in: Lindner u. a., Verfassung des Freistaates Bayern, 2. Aufl., 2016, Art. 88 Rn. 1. ↩︎
- Petra Michaelis-Merzbach, in: Driehaus (Hrsg.), Verfassung von Berlin, 2002, Art. 79 Rn. 14. ↩︎
- Rüdiger Postier/Hasso Lieber, in: Simon/Franke/Sachs, Handbuch der Verfassung des Landes Brandenburg, 1994, § 19 Rn. 20; ebenso Hasso Lieber, in: Lieber/Iwers/Ernst (Hrsg.), Verfassung des Landes Brandenburg, 2012, § 108, S. 663 f. ↩︎
- Hans Wrobel, in: Fischer-Lascano (Hrsg.) u. a., Verfassung der Freien Hansestadt Bremen, 2016, Art. 135 Rn. 3. ↩︎
- Ralf Zimmermann, in: Baumann-Hasske (Hrsg.), Die Verfassung des Freistaates Sachsen, 4. Aufl., 2021, Art. 78 Rn. 21. ↩︎
Zitiervorschlag: Hasso Lieber, Die Kompetenz der Länder bei der Besetzung der Gerichte, in: LAIKOS Journal Online 3 (2025) Ausg. 1, S. 4-6.