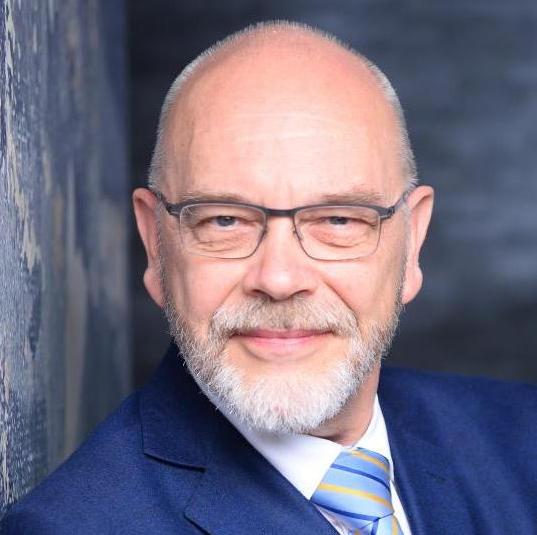V. M. Haug: Partizipationsrecht
Volker M. Haug: Partizipationsrecht. Fundierung und Vermessung eines Rechtsgebiets. Baden-Baden: Nomos-Verl. 2024. 810 S. (Neue Schriften zum Staatsrecht; Bd. 16) Print-Ausg.: ISBN 978-3-7560-1320-3 € 229,00; E-Book (kostenfrei) DOI 10.5771/9783748918233
Der Begriff der Partizipation hat in der politischen Diskussion einen Platz erobert, der eine wissenschaftlich-kritische Analyse erforderlich macht. Die Glaubensbekenntnisse, die sowohl für als auch gegen eine Ausweitung der Teilhabe der Zivilgesellschaft an den staatlichen und vor allem kommunalen Entscheidungen abgegeben werden, müssen durch eine systematische und fundierte Basis ersetzt werden. Hierzu macht die 2024 von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg als Habilitationsschrift angenommene Arbeit einen großen Schritt in die richtige Richtung. Sie beginnt mit der Präzisierung der Terminologie, wobei die rechtswissenschaftlichen Begrifflichkeiten auf das in Politikwissenschaft und Soziologie bereits entwickelte Verständnis zurückgreifen können. In einer politischen Situation, in der Begrifflichkeiten so vielgestaltig benutzt werden, dass jeder seine ablehnende oder zustimmende Auffassung darunter subsumieren kann, ist eine eindeutige Sprache wichtig und steht an der Spitze jeder Diskussion. Erst darauf kann eine ideologiefreie Abgrenzung von Inhalt und Reichweite der Partizipation in den unterschiedlichen Bereichen fruchtbar gemacht werden. Aus dem Recht, „sich unabhängig von der Betroffenheit subjektiver Rechte an der Entstehung hoheitlicher Entscheidungen von überindividuellem Interesse fakultativ und ohne Verpflichtung zu beteiligen“, werden in fünf Kapiteln Informations-, Anregungs-, Konsultations-, Mitgestaltungs- und Entscheidungsrechte auf Bedeutung, Funktion und Umsetzung geprüft. Die Bandbreite reicht von der Transparenz staatlichen Handelns gegenüber dem Bürger durch offene Information bis hin zur direktdemokratisch-verbindlichen Entscheidung im Bürgerentscheid. Die Bereiche stellen eine Acht-Sprossen-Leiter von der ersten Stufe der Nicht-Partizipation über die partnerschaftliche Entscheidung bis hin zur Übertragung der Entscheidungsgewalt auf die Bürgerschaft dar. Auf der staatlichen Seite beteiligt sind die Verwaltung (Exekutive) und die Gesetzgebung (Legislative). Die Rechtsprechung und die Beteiligung ehrenamtlicher Richter kommen in diesem Schema nicht vor – systematisch nachvollziehbar, da „die verbindliche Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten allein den Gerichten vorbehalten ist“ (S. 661) und ein Kollegialgericht mit ehrenamtlicher Beteiligung als entscheidender Spruchkörper erst entsteht, wenn die Teilnahme der richtigen Ehrenamtlichen (gesetzlicher Richter) gesichert ist. Gerade diese Partizipation ist zunehmend gefährdet, weil der politische wie professionelle Teil der Rechtspflege sich von der Beteiligung „aus dem Volke (laikos)“ zunehmend abwendet – allen Beteuerungen ihrer Wichtigkeit zum Trotz.
Die von der Habilitationsschrift vorgenommene „Fundierung und Vermessung“ eines Rechtsgebiets, dessen Konturierung in der öffentlichen Diskussion häufig nur unscharf ist, muss gleichwohl wegen der systematischen und umfassenden Darstellung beeindrucken. Die Möglichkeit, etwa durch eine Volksinitiative die Auflösung des Parlaments herbeizuführen, dürfte auch bei Engagierten nicht zum Alltagswissen gehören. Die breite Darstellung nicht nur der rechtlichen, sondern auch der praktischen Möglichkeiten wie ggf. auch der Manipulationsgefahren werden das Buch zu einem Standardwerk und Vademecum für Bürgerbeteiligung machen. Die begriffliche wie inhaltliche Schärfe wird zum politischen Erfolg partizipativen Engagements beitragen. Verlag und Autor muss für den kostenfreien Abruf des E-Books Dank ausgesprochen werden. (hl)
Zitiervorschlag: Hasso Lieber, V. M. Haug: Partizipationsrecht [Rezension], in: LAIKOS Journal Online 3 (2025) Ausg. 1, S. 31-32.